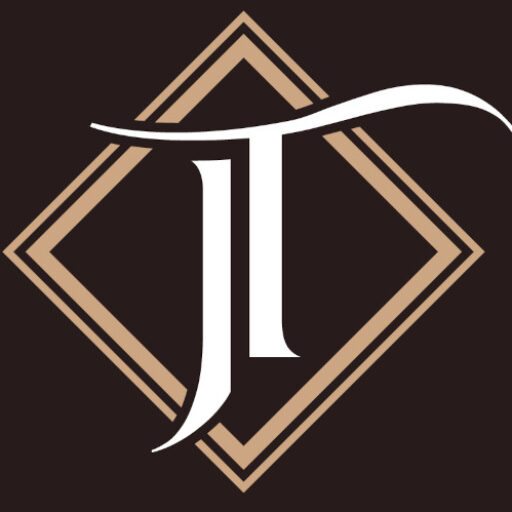Die folgende Geschichte zeigt die Bedeutung der Buchhaltung im Steuerrecht: Aus einer Finanzierungsrunde ein resultiert wegen der gewählten Verbuchungsmethode ein handelsrechtlicher Gewinn. Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips muss sich das Unternehmen auf einen steuerbaren Gewinn behaften lassen. Möglich gewesen wäre auch eine steuerneutral ausschüttbare Kapitaleinlagereserve.
Von der Wichtigkeit der vollständigen und korrekten Verbuchung
Erfahrene Treuhänder kennen das: Spätestens beim Jahresabschluss stellt sich die Frage der Vollständigkeit der verbuchten Positionen. Insbesondere beim Aufwand ist man penibel darum bemüht, jede Rechnung zu berücksichtigen, man stellt sich Fragen zur Aktivierbarkeit und Periodizität.
Welcher steuerliche Grund führt dazu?
Was versteckt sich hinter dem Massgeblichkeitsprinzip?
Definition
Im Gewinnsteuerrecht gilt der Grundsatz der Massgeblichkeit der Handelsbilanz: Die handelrechtliche Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) bilden Ausgangspunkt und Grundlage für die steuerrechtliche Gewinnermittlung. Die Steuerbehörden sind verpflichtet, auf die von den zuständigen Organen verabschiedete Jahresrechnung abzustellen. Vice versa muss sich die Gesellschaft auf ihrer Jahresrechnung behaften lassen.
Denn:
Gerade beim Aufwand heisst es vor dem Steueramt: Was nicht verbucht wurde, kann bei den Steuern nicht abgezogen werden. Zu Grunde liegt hier das sogenannte Massgeblichkeitsprinzip, welches für die direkten Bundessteuern in Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG stipuliert ist.
Was bedeutet das konkret?
Eine Kreditoren-Rechnung, die das Geschäftsjahr 01.01.2023 – 31.12.2023 betrifft, wird in der Buchhaltung 2023 erfasst. Sie vermindert in der Folge den steuerbaren Reingewinn.
Wird die Kreditoren-Rechnung am 29.12.2023 (=letzter Arbeitstag im Jahr 2023) ausgestellt und verschickt, kommt sie anfangs Januar 2024 beim Kunden an und kann auch erst im Jahr 2024 bezahlt werden. Ist der Buchhalter unachtsam, vergisst er eine Abgrenzung und die Rechnung verbleibt in der Buchhaltung 2024. Dumm gelaufen oder ergeben sich (steuerliche) Konsequenzen?
Wie beurteilt das Steueramt?

Grundsätzlich geht das Steueramt vom verbuchten Reingewinn aus (Art. 57 DBG, sog. Massgeblichkeitsprinzip).
Daraus folgt: Was nicht verbucht wird, ist steuerlich zuerst einmal nie passiert. Für eine entsprechende Korrektur benötigt es grundsätzliche eine konkrete steuerliche Vorschrift oder eine Steuerumgehung.
Der Aufwand betrifft das Jahr 2023, wird aber im Jahr 2024 verbucht. Folglich würde er den Gewinn 2024 betreffen.
Welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich daraus?
Im Jahr 2023 wurde kein entsprechender Aufwand verbucht, das Steueramt hat keine Kenntnis davon uns er wird auch nicht steuermindernd berücksichtigt.
Im Jahr 2024 ist ein Aufwand für das Jahr 2023 verbucht. Steuerrechtlich sprechen wir von periodenfremdem Aufwand – und wird unter diesem Titel nicht anerkannt.
Mit diesem Hintergrundwissen widmen wir uns der folgenden Geschichte.
Die Geschichte vom Geschäftsführer, der von der Buchhaltung nicht viel verstand
Die Buchhaltung, die aus Unwissenheit entstand
Ein sehr skurriler «Fall» ereignete sich, als ein Elektro-Ingenieur sich für seine Gesellschaft auch als Buchhalter betätigte. Und das kam so:
Die Gesellschaft war eine Art Spin-Off einer seit Langem erfolreichen grösseren Unternehmung. Aufgrund von Differenzen in der Geschäftsleitung trennte sich ein Teil des Personals und machte sich selbstständig.
Der bereits erwähnte Elektro-Ingenieur fungierte als Alpha-Männchen und gründete eine neue Gesellschaft, die er zu 100% liberierte. Im ersten Geschäftsjahr verkaufte er einen Teil seiner Aktien in die Gesellschaft, die nunmehr eigene Aktien hielt.
Damit sich die neuen Geschäftsleitungsmitglieder nach und nach an der Unternehmung beteiligen konnten, kauften diese wiederum diese eigenen Aktien. Der Kaufpreis setzte sich aus dem Nennwert sowie einem Agio zusammen, während die Gesellschaft zeitgleich einen Verlust generierte.
Sozusagen eine klassische Startup-Finanzierung.
Leider verbuchte der Elektro-Ingenieur als eben ungelernter Buchhalter diese Verkäufe wie folgt:
- Anteil Nennwert über die eigenen Aktien
- Anteil Agio als (steuerbarer) Ertrag
Wie wird dies steuerlich beurteilt?
Die Gesellschaft wies einen steuerbaren Gewinn aus, der sich aus dem Verlust aus Betriebstätigkeit sowie dem «Gewinn» aus dem Verkauf der eigenen Aktien ergab. Aufgrund des Massgeblichkeitsprinzips entsprach der ausgewiesene Gewinn dem steuerbaren Gewinn.
Wieso tat dies so weh?
Die «Agio-Zahlung» hätte als Einlagen in die Reserven (separat) verbucht werden können («Reserven aus Kapitaleinlagen, KER»). Gemäss Art. 60 lit. b DBG sind Kapitaleinlagen sowie Aufgelder nicht steuerbar. Schade, handelte es sich doch um rund CHF 200’000…
Des Weiteren hätte die Gesellschaft bei einer allfälligen späteren Gewinnausschüttung bei der Verrechnungssteuer profitieren können:
Hätte sie die «KER» separat ausgewiesen und der ESTV innerhalb der gesetzlichen Frist gemeldet, hätte sie die Kapitaleinlagereserven verrechnungssteuerfrei ausschütten können (vgl. Art 5 Abs. 1bis VstG).
Die Unkenntnis des Geschäftsführers setzt sich fort
Mit demselben Geschäftsführer diskutierte ich (anlässlich der damals durchgeführten Buchprüfung) auch die private Benützung des Geschäftsfahrzeugs. Weil kein Privatanteil abgerechnet wurde, verlangte ich das Fahrtenbuch, welches in solchen Fällen vorgeschrieben war. Dieses führte er nicht, reichte mir aber eine «Variante» nach:
Auf seinem Fahrtenbuch wurden nur Privatfahrten mit benutzten Kilometern aufgeführt. Von lückenloser Beweisführung hat er noch nie was gehört und war in der Folge nicht begeistert, als er den pauschalierten Privatanteil für die Benützung des Geschäftsfahrzeugs aufgerechnet bekam.
Nach wenigen Jahren der Geschäftstätigkeit erhielt ich zusätzlich zur Steuererklärung auch einen Ausscheidungsvorschlag – für ein Konsignationslager in Österreich. Immerhin: Eine Steuernummer für die ausländische Umsatzsteuer hatte er. Allerdings hat er nie wirklich verstanden, wieso er direktsteuerlich in Österreich gar nicht steuerpflichtig war.
Exkurs: Bilanzänderung vs. Bilanzberichtigung
Bilanzänderung
Unter Bilanzänderung versteht man die Änderung einer handelsrechtskonformen Buchung durch eine ebenfalls handelsrechtskonformen Buchung. Eine Bilanzänderung nur bis zum Einreichen der Steuererklärung möglich.
Ein Beispiel hierzu ist der Wechsel der Abschreibungsmethode (linear, degressiv) bei einem neu angeschaffenen Aktivum.
Bilanzberichtigung
Bei der Bilanzberichtigung wird eine handelsrechtswidrige Buchhaltung berichtigt durch einen handelsrechtskonformen Ansatz. Praxisgemäss ist dies bis zum Eintritt der Rechtskraft der definitiven Steuerveranlagung möglich. Eine Bilanzberichtigung ist von Amtes wegen durchzuführen.
Ein Beispiel dazu ist die Überbewertung eines Aktivums: Per Stichtag wurde die gesamte EDV-Anlage eines Unternehmens entsorgt, weshalb nicht die pauschale Abschreibung/Wertberichtigung von z.B. 40% berücksichtigt werden kann, sondern das Aktivum komplett abgeschrieben bzw. ausgebucht werden muss. Ansonsten liegt eine Überbewertung vor.
Aktuelle Rechtsprechung: Massgeblichkeitsprinzip
In einem neueren Entscheid hat das Bundesverwaltungsgericht zum Thema Kapitaleinlage Stellung zum Massgeblichkeitsprinzip genommen: Im Entscheid ging es darum, ob es sich bei der Einbringung von Wirtschaftsgütern von aussen in ein Unternehmen um eine Kapitaleinlage nach Art. 5 Abs. 1bis VStG (bzw. Art. 60 lit. a DBG) handelt.
Die Quintessenz des 40-seitigen Urteils (welches vor Bundesgericht angefochten ist) zeigt:
Wird eine Einbringung eines Wirtschaftsgutes von der Gesellschaft selber als Ertrag verbucht, wird damit zum Ausdruck gebracht, dass es sich aus Sicht der Gesellschaft eben gerade nicht um eine Kapitaleinlage handelt. Darauf hat sich die Steuerpflichtige grundsätzlich behaften zu lassen. Das Massgeblichkeitsprinzip spricht in derartigen Konstellationen gegen eine spätere Umbuchung und Ausweisung desselben Wirtschaftsgutes als Kapitaleinlage.
Urteil vom 03.10.2023, BVGer A-3032/2021, E. 7.3
Gerade im Bereich der Verrechnungssteuer ist es somit (vorläufig) zwingend, dass die (Reserven aus) Kapitaleinlagen auf einem gesonderten Konto in der Handelsbilanz zum Zeitpunkt der Leistung oder zeitnah erfolgen muss (VVGer A-3032/2021, E. 7.4.3). Ohne dieses Erfordernis unterliegt die Ausschüttung der Verrechnungssteuer.
Zudem ist eine nachträgliche Umbuchung nicht möglich, da beide Verbuchungsvarianten handelsrechtskonform sind. Eine Bilanzänderung ist somit für die Steuerbehörden nicht verbindlich.