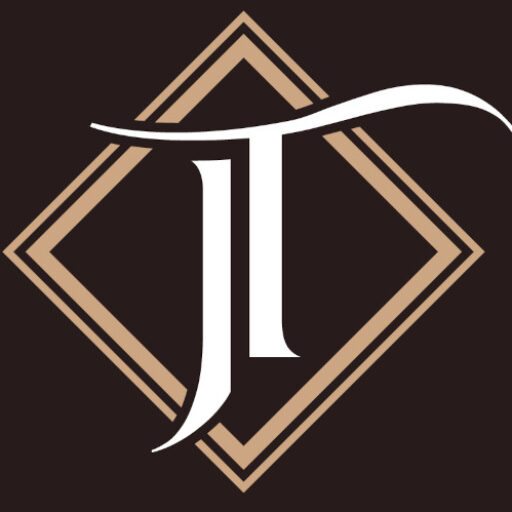Dieser Unternehmer, der keine Steuern zahlen wollte, scheint ganz nach dem Motto «Catch me – if you can!» zu leben. Was er sich alles einfallen liess, um die Steuerbelastung für sein Unternehmen zu optimieren und wie das bei der Steuerverwaltung ankam, gibts zusammengefasst in dieser modernen Katz-und-Maus-Geschichte. Wer war da wohl die Katze?
(Keine) Steuern zahlen: Was steckt dahinter?
Auf kurze Sicht – und ebenso für Kurzsichtige – scheint es erstrebenswert, keine Steuern zu bezahlen. Zugegeben, Steuern tun uns allen irgendwie weh. Doch schliesslich bedeutet Steuern zahlen auch, dass man ein Einkommen bzw. einen Gewinn zu versteuern hat. Vice versa zeigt sich – vordergründig zumindest – dass «keine Steuern» gleichbedeutend ist mit «kein Einkommen». Und das ist eigentlich schon hart.
Renitente Steuerpflichtige: Die Wurzel allen Übels
Ein Unternehmer, der es als erkanntes Ziel proklamierte, im Kanton Thurgau möglichst keine Steuern zu zahlen, spielt hier die Hauptrolle. Jahr für Jahr liess er sich etwas Neues einfallen. Jahr für Jahr war es ein «Katz-und-Spiel», ob und wie er mit seinen Ideen durchkommt.
Jedes Jahr forderte es ein wenig Überwindung, die Steuererklärung dieser Unternehmung in die Hände zu nehmen, anzuschauen und zu ermitteln, was es dieses Jahr wieder Neues zu entdecken gab.
Am ehesten würde ich diesen Menschen als freundlichen Giftzweg beschreiben. Es waren nicht direkt seine Umgangsformen. Es war eher so, dass er sich nichts sagen lassen wollte und per se gegen den Staat war.
Woher kam das bloss? Who knows.
Der erste Streich: Der Unternehmer, der keine Steuern zahlen wollte
Das «Kennenlernen» beginnt
Kaum hatte ich bei der Steuerverwaltung mit meiner Arbeit begonnen, wurde mir dieser «Fall» umgeteilt. Der letzte Steuerkommissär musste (bzw. eigentlich eher durfte) den Fall abgeben, da die steuerpflichtige Gesellschaft dies nach wiederholten Vorfällen so wünschte.
Dass das letzte veranlagte Steuerjahr mit einem Rekursentscheid endete, fand ich zumindest nicht beruhigend.
Als die Steuererklärung eintrudelte, prüfte ich also die Jahresrechnung. Sogleich fiel mir eine Position auf, die im Vergleich zu den Vorjahren markant angestiegen war. Es war der Beratungsaufwand. Da die geschäftsmässige Begründetheit nicht offensichtlich war, forderte ich Belege und Begründung ein.

Das Kennenlernen mit der steuerpflichtigen Gesellschaft wird intensiver
Neben Rechnungen eines Drittanbieters für ein neues Tool zum Betrieb des eigenen Onlineshop fanden sich auch etwas uncoolere Rechnungen in der Post: Stundenabrechnungen des Inhabers, welche seinen Effort zur Bereitstellung der Produktdaten ins neue Tool darlegten. Sollte das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit sein?
Eine kurze Abklärung mit den Kollegen, die für die private Steuerveranlagung verantwortlich waren, bestätigte dies. In der Buchhaltung für die «selbstständige Unternehmensberatung» waren natürlich wieder unzählige Kosten gegenverrechnet.
Für solche Fälle und Momente liebte ich die steuerlichen Meldungen…. Schwups waren diese Rechnungen in Lohn umqualifiziert und die Steuerkommissäre, die den Unternehmer privat veranlagten, wussten Bescheid….
Der zweite Streich folgt: Neue Herausforderung für die Steuerverwaltung
Keine Steuern zahlen im Kanton Thurgau?
Ein Jahr später war der Unternehmer besser vorbereitet: Neu befand sich ein Ausscheidungsvorschlag bei den Steuerunterlagen. Anscheinend gab es neu eine Betriebsstätte in einem weiteren Ostschweizer Kanton. Für eine Gesellschaft, welche einen Onlineshop betreibt? Hmm, nun gut, das wird zu prüfen sein.
Da die Geschäftstätigkeit und die Zahlen aus der Jahresrechnung nichts für die Beurteilung einer Betriebsstätte hergaben, verlangte ich Unterlagen zum Nachweis ein.
Betriebsstätte zu beurteilen: In welchem Kanton zahlt das Unternehmen Steuern?
Erhalten habe ich eine fadenscheinige Begründung, eine Adresse (welche zu einem Ferienhäuschen gehörte) und ein interessantes Foto:
Das Foto zeigte einen kleinen Tisch vor einem Fenster, darauf ein Laptop ohne Strom-Kabel, eine kleine PC-Maus und so etwas wie einen portablen Drucker sowie einen Küchenstuhl aus Holz.
Reicht dies für die Begründung einer Betriebsstätte?
Art. 4 Abs. 2 DBG
«Als Betriebsstätte gilt eine feste Geschäftseinrichtung, in der die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens oder ein freier Beruf ganz oder teilweise ausgeübt wird. Betriebsstätten sind insbesondere Zweigniederlassungen, Fabrikationsstätten, Werkstätten, Verkaufsstellen, ständige Vertretungen, Bergwerke und andere Stätten der Ausbeutung von Bodenschätzen sowie Bau- oder Montagestellen von mindestens zwölf Monaten Dauer.»
Dass die Platzierung eines Laptops, dass noch nicht mal am Strom angeschlossen ist, ein auf Dauer angelegter Arbeitsplatz sein soll, wo die Geschäftstätigkeit zumindest teilweise (in casu: Erfassung von Produkten im Onlineshop) vorgenommen wird, wobei es sich bei der Örtlichkeit um ein Ferienhäuschen handelt, ist schon weit hergeholt. Aufgrund des Einzelfalls (Personal, Geschäftstätigkeit, Zweck) und der (steuerlichen) Vorgeschichte des Unternehmens und nach der allgemeinen Lebenserfahrung jedoch klar widerlegbar. Insbesondere die stundenlange Arbeit auf dem unbequemen Holzstuhl stellte ich mir sehr effizient vor.
Ob ich hier nach dem Einspracheverfahren «Ruhe» hatte oder noch die Extra-Runde vor die Steuerrekurskommission fahren musste, weiss ich nicht mehr.
Oups: Streich Nummer drei stellt die Steuerverwaltung vor ein Dilemma
Im dritten Jahr schliesslich hatte der Unternehmer wohl genug mit den Disskussionen: Er gründete eine (weitere) Gesellschaft in besagtem Ostschweizer Kanton – an der Adresse des Ferienhäuschens.
Die in Rechnung gestellten Aufwendungen flossen somit nicht mehr in die «falsche» Betriebsstätte, sondern in eine andere juristische Person. War dies das Ende vom Lied? Sollten wir das so akzeptieren? Schliesslich muss das Unternehmen Steuern zahlen – wenn auch in einem anderen Kanton. Allerdings wären die Aufwendungen schwierig zu kontrollieren, und bei solch einem findigen Unternehmer wäre es gut möglich, dass er von nun an zweigleisig fahren wird (sprich: Rechnungen an zwei Orten verbucht).
Die Antwort lautete deshalb: Mitnichten werden wir das so akzeptieren. Wer auch immer auf die Idee kam – renitente Steuerpflichtige forderten die Steuerbehörden ja quasi zum Tun auf. Na dann bitte:
Strategie festlegen
weiteren involvierten Kanton infomieren
Steuerdomizil prüfen
Steuerdomizilentscheid fällen
Ich glaube mich zu erinnern, dass Streich Nr. 3 genügend Diskussionsstoff für einen Rekurs bot… Gewonnen hat dann natürlich die Katze!
Learnings
Aus den Erfahrungen des renitentesten «Kunden», den ich bei der Steuerverwaltung hatte, habe ich hier Tipps für eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden zusammengestellt:
1️⃣ Legen Sie sich nicht mit den Steuerbehörden (und ihren Mitarbeitenden) an – ausser man ist Profi und berücksichtigt die nachfolgenden Tipps.
2️⃣ Halten Sie sich an getroffene Abmachungen.
3️⃣ Verhalten Sie sich stets sachlich und professionell.
4️⃣ Konsultieren Sie wenn nötig den Verhaltenskodex Steuern von der SSK.
5️⃣ Setzen Sie sichh nicht selbst auf die «Abschussliste», indem andauernd neue grenzwertige Konstellationen ausprobiert werden.
6️⃣ Seien Sie kompromissbereit.
7️⃣ Kommunizieren Sie offen, zeitnah und ehrlich (Lügen haben kurze Beine).
8️⃣ Seien Sie Ihr bester Anwalt.
Warum nicht einfach mal stolz sein, wenn man Steuern zahlen «darf»? Man hat es sich schliesslich verdient.